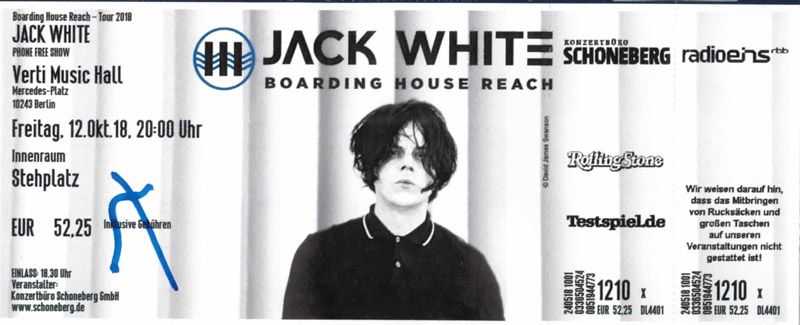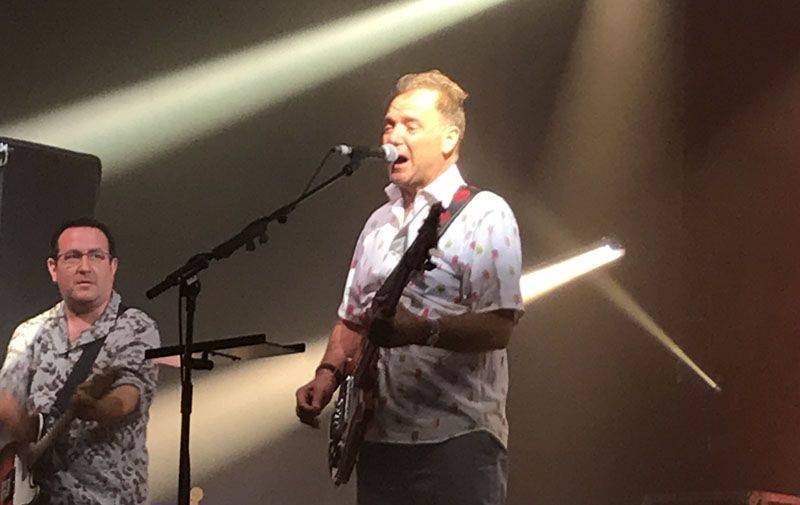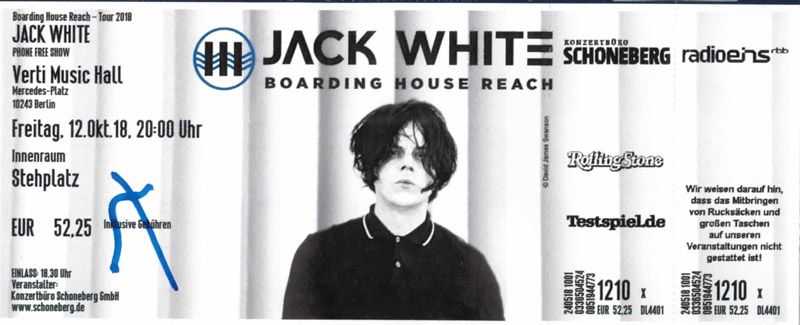
Eine neue Konzerthalle in Berlin. Von außen an eine übergroßen Dunkin’ Donut-Filiale erinnernd, von Innen mit dem Charme ein Multiplex-Kinos. Der Konzertsaal selbst ist sehr hoch und ein Raum ohne besondere Eigenschaften. Ton und Sicht einwandfrei, das ist ja das Wichtigste. Die Sanitäranlagen sind „für hohe Gleichzeitigkeiten“ bemessen – der Laden ist schon ganz OK. Beim rausgehen musste ich am Treppen-Nadelöhr unweigerlich an einige Staus in der Columbiahalle denken…- kann ja noch werden. Deutlich mehr Charme und Atmosphäre verströmt erwartungsgemäß das liebgewonnene und etwas kleinere Tempodrom. Über die „Urban-Entainment“-Konsumvorhölle vor der Tür verliere ich an dieser Stelle kein weiteres Wort.
Als Vorband trat die Berliner Gruppe Gewalt auf – ein mutige aber auch passende Wahl. Dabei wurden im Widerschein einer blauen Rundum-Leuchte über fett-technoid anmutende Beats und schroffe Dröhngitarren Parolen wie „Das neue Gold heißt Pfand!“ und „Ihnen droht Obdachlosigkeit,…Ob-dach-los-ig-keit!“ proklamiert. Zur Einweihung einer Halle deren Geld- und Namensgeber ein multinationaler Versicherungskonzern ist, hatte das natürlich einen gewissen Charme. Für ästhetisch und und musikalisch strenge Konzepte ist ja auch der Protagonist des Abends bekannt.
Die Mobiltelefone wurden für diesen Abend zum Zwecke der Konzentration aufs Wesentliche in grüne Filztäschlein verbannt – ein interessantes und aus meiner Sicht erfolgreiches Konzept. Vielleicht gibt es künftig ähnliche Lösungen für die Besucher, die, sobald ein etwas leiserer oder langsamerer Song kommt, immer unbedingt ihre Nachbarn lautstark volllabern müssen? Nur so ein Gedanke.
Jack White begann auch gewaltig mit einer Schrammelrock-Orgie über wüsten Beat der Ausnahmetrommlerin Carla Azar. Vor seiner selbst verordneten Konzertpause waren Whites Konzerte durch Besetzungen mit Geige und Steel–Gitarre aufgefallen. Nun hat er sich einen vermeintlich moderneren Sound verordnet und tritt – neben der extrem kompakten Rhythmusgruppe zu seiner rechten – mit zwei Tastenmännern auf, die fetteste Synthesizern und Sample-Pads bedienen. So erhebt sich ein fetter Schweinerocksound, bei dem die Orgel manchmal die zweite Gitarre ersetzen und die erste auch mal wegdrücken statt einzurahmen. Manchen Songs seines Best-of-der-ganzen -Karriere-Programmes tut das besser als anderen.
Weiterlesen